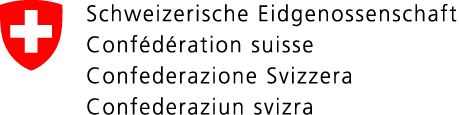Der Götterbaum breitet sich im milden Klima der Südschweiz immer weiter aus. Die Folgen für den Schutzwald und die Biodiversität waren bislang unklar. Das Vorkommen und die ökologischen Ansprüche dieser invasiven gebietsfremden Baumart konnten analysiert und geeignete Strategien zur Bewirtschaftung und Bekämpfung entwickelt werden.
Pilotprojekt zur Anpassung an den Klimawandel «Vorkommen, Ökologie und Kontrolle des Götterbaums in der Schweiz»

Ausgangslage
Der Götterbaum (Ailanthus altissima) breitet sich seit einigen Jahrzehnten auf der Alpensüdseite stark aus. Auch nördlich der Alpen gibt es erste Vorkommen. Die sehr schnell wachsenden, relativ kurzlebigen Bäume neigen zu reinen und dichten Beständen. Haben sich Götterbäume einmal etabliert, ist es schwierig, die Art mit herkömmlichen waldbaulichen Massnahmen wieder zu entfernen oder zu kontrollieren.
Ziele
Ziel des Projekts war es, das Vorkommen des Götterbaums in der Schweiz und seine ökologischen Ansprüche erstmals umfassend zu analysieren. Dies sollte ermöglichen, künftige Strategien für eine effiziente und umweltschonende Bewirtschaftung und Bekämpfung zu entwickeln. Das Projekt sollte Entscheidungshilfen für die Forstpraxis liefern und zu einem besseren Management der Götterbaumvorkommen beitragen.
Vorgehen
- Erstellen einer Götterbaum-Karte für die Schweiz anhand verschiedener Datenquellen (kantonale Erhebungen, Landesforstinventar, eigene Beobachtungen etc.)
- Analyse der ökologischen Nische des Götterbaums und Modellieren der potenziellen zukünftigen Verbreitung
- Aufbau eines Netzwerks von Dendrometern und einfachen Klimastationen zur Erfassung von Wachstumsschwankungen bei Trockenheit, Analyse der Wachstums- und Verjüngungsdynamik
- Bekämpfungsexperiment durch Ringeln des Götterbaums an zwei Standorten
- Begleiten chemischer Bekämpfungsmassnahmen in Liechtenstein
Ergebnisse
In Wäldern nördlich der Alpen konnten überraschend viele Vorkommen des Götterbaums lokalisiert werden (über 90 Standorte). Die beobachtete Ausbreitung wurde grösstenteils durch den Menschen verursacht (Siedlungen, Strassen, waldbauliche Eingriffe) und begünstigt durch natürliche Störungen (Waldbrände, Bestandeszusammenbrüche) und milde Temperaturen (ab einer Jahresmitteltemperatur von 9 °C). Die Entwicklung dieser Faktoren lässt eine weitere Vergrösserung des potenziellen Verbreitungsgebiets erwarten.
Die Verjüngungsanalysen bestätigten eine erhöhte Schattentoleranz des Götterbaums auf Waldstandorten. Zudem deuten die Messungen auf einen geringeren Kernfäuleanteil hin als erwartet.
Die mechanischen Bekämpfungsversuche mit der Ringelungsmethode nach Martin Ziegler verliefen erfolgversprechend. Dabei durchtrennt man in drei durchgehenden Ringen um den Baum die Saft transportierende Rinde, das Kambium und den äusseren Teil des Splintholzes. Eine abschliessende Beurteilung der Methode ist allerdings erst nach etwa vier Jahren möglich. Die chemische Bekämpfung mit einem Herbizid in Liechtenstein schien ebenfalls gut zu funktionieren. Noch nicht geklärt ist, ob sich die Herbizidmenge reduzieren lässt.
Fazit
Der Götterbaum ist ein gutes Beispiel für einen Baumneophyten, der nach jetzigem Wissensstand regional differenziert bewirtschaftet werden muss. Innerhalb der relativ kleinen Untersuchungsgebiete birgt die Ausbreitung des Götterbaums Risiken und Chancen. Damit ergibt sich die Notwendigkeit, den Baum sowohl zu bekämpfen als auch mit ihm zu leben.
Das Projekt lieferte eine Reihe neuer Erkenntnisse. So ist auf den neu besiedelten Standorten nördlich der Alpen eine komplette Elimination der relativ wenigen und meist sehr jungen Bäume noch mit vertretbarem Arbeits- und Kostenaufwand zu erreichen. Als Bekämpfungsmethode sollte die in der Vergangenheit oft als erfolglos bezeichnete mechanische Ringelung wieder als Option betrachtet werden. Offen bleibt die Frage der Kernfäuleresistenz nach Verletzungen durch Steinschlag. Dazu laufen weitere Untersuchungen.
Der Schlüssel zum erfolgreichen Management des Götterbaums ist ein umfassendes Monitoring. Wegen seiner Schattentoleranz sollte das Monitoring auf geschlossene Bestände in der Nähe von Samenbäumen ausgedehnt werden. Darüber hinaus sollten die Forstdienste besser geschult werden, um neue Vorkommen rasch zu identifizieren und Verwechslungen zu vermeiden.
Projektträger: Eidg. Forschungsanstalt für Wald, Schnee und Landschaft WSL
Pilotgebiet: Schweiz
Laufzeit: 2014 - 2016
Begleitung: Bundesamt für Umwelt
Weiterführende Informationen
Dokumente
Vorkommen, Ökologie und Kontrolle von Götterbäumen in der Schweiz - Zusammenfassung (PDF, 292 kB, 06.10.2017)Eidg. Forschungsanstalt für Wald, Schnee und Landschaft WSL
Letzte Änderung 13.10.2017
Kontakt
WSL
Marco Conedera
Jan Wunder
marco.conedera@wsl.ch
jan.wunder@wsl.ch
____________________________
Bundesamt für Umwelt BAFU
Klimaberichterstattung und –Anpassung
Papiermühlestr. 172
3063 Ittigen